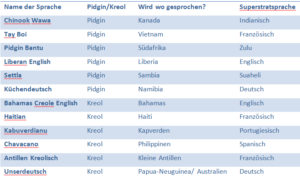(Martina Heinle)
Die Begriffe Kollektives Gedächtnis und Erinnerungsorte sind zunächst einmal nicht als getrennt voneinander zu betrachten, vielmehr können Erinnerungsorte als ein Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses verstanden werden. Beide Ansätze entstammen der Erinnerungsforschung und sind im Fach Deutsch als Fremdsprache im Bereich des kulturellen Lernens verortet. Die Konzepte werden hier vor allem in Bezug auf die Frage diskutiert, auf welche Weise sich die Vermittlung von Landeskunde bestmöglich in den Fremdsprachenunterricht integrieren lässt, ohne dabei eine stereotype und monoperspektivische Darstellung der Zielsprachenkultur zu riskieren oder auf die Vermittlung von reinem Faktenwissen hinauszulaufen. Dabei haben erinnerungs-perspektivische Ansätze ein enormes Potential für den fremdsprachlichen Landes-kundeunterricht, sie bergen jedoch auch Risiken, die es in Überlegungen zur Didaktisierung und bei der Erstellung von Unterrichtsmaterialen zu berücksichtigen gilt.
Kollektives Gedächtnis und Erinnerungsorte: Herkunft und Theorie der Konzepte
Das Konzept des kollektiven Gedächtnisses (mémoire collective) stammt vom Soziologen Maurice Halbwachs und geht davon aus, dass soziale Gruppen über gemeinsame Erinnerungen verfügen, welche in einem kollektiven Gedächtnis gebunden sind und eine identitätsstiftende Funktion für die den Gruppen angehörigen Individuen besitzen. Die These des kollektiven Gedächtnisses erschien im Werk Les cadres sociaux de la mémoire (Halbwachs 1925), welches 1985 unter dem Titel Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen ins Deutsche übersetzt wurde, sowie in La mémoire collective (Halbwachs 1939). Jan Assmann (1988:9) hebt hervor, dass Maurice Halbwachs, ebenso wie Aby Warburg mit dessen Konzept des sozialen Gedächtnisses, kollektiv geteiltes Wissen nicht mehr wie ehemals in der Biologie, sondern nun in der Kultur situiert.
Weitergedacht wurde das Konzept des kollektiven Gedächtnisses von Jan und Aleida Assmann, die zwischen einem kommunikativen und einem kulturellen Gedächtnis differenzieren. Maßgeblich unterscheidende Merkmale dieser beiden Bestandteile des kollektiven Gedächtnisses liegen vor allem in der Distanz zum Alltag, dem Zeithorizont sowie den jeweiligen Trägern (vgl. J. Assmann 1988:11 ff.): So zeichnet sich das kommunikative Gedächtnis durch eine hohe Alltagsnähe aus und ist in kommunikativen Situationen bzw. im sprachlichen Austausch unter Mitmenschen erkennbar, wie z. B. beim Erzählen eines Witzes oder eines Erlebnisses. Es „entsteht […] in einem Milieu räumlicher Nähe, regelmäßiger Interaktion, gemeinsamer Lebensformen und geteilter Erfahrungen“ (A. Assmann 2014:23). Das kommunikative Gedächtnis reicht nur zwischen 80 bis maximal 100 Jahre in die Vergangenheit zurück, weshalb Aleida Assmann (2014:23) auch vom „Kurzzeitgedächtnis einer Gesellschaft“ spricht. Mit dem Wechsel der Generationen verschiebt sich auch der Zeithorizont. Das kulturelle Gedächtnis dagegen hat eine viel größere zeitliche Reichweite, die potentiell über Jahrhunderte zurückreichen kann und sich nicht mit dem Generationenwechsel verschiebt. Das bedeutet jedoch nicht, dass das kulturelle Gedächtnis unveränderlich und starr ist, denn es enthält sogenannte Erinnerungsfiguren (vgl. J. Assmann 1988:12 f.), deren Stellung im Gedächtnis dynamisch und veränderbar ist (vgl. dazu auch das Konzept vom Speicher- und Funktionsgedächtnis bei A. Assmann 2014:54 ff.). Die Bestände des kulturellen Gedächtnisses zeichnen sich durch ihre Alltagsferne aus und bestehen losgelöst von den lebenden Individuen auf materiellen Trägern bzw. Medien (zur Mediengebundenheit kultureller Erinnerungsbestände s. Badstübner-Kizik 2015a).
Der bei Assmann verwendete Begriff der Erinnerungsfiguren verweist auf das Konzept der Erinnerungsorte (lieux de mémoire) von Pierre Nora. In einem siebenbändigen Werk sammelte Nora über 130 Aufsätze zu nationalen Erinnerungsorten des französischen Kollektivgedächtnisses (vgl. Nora 1984–1992). Unter den Erinnerungsorten sind nicht ausschließlich geographische Orte zu verstehen, sondern „all jene Phänomene, über die eine Nation, sei es bewusst oder unbewusst, ihre kollektive Erinnerung und Identität konstruiert und kontinuiert“ (Fornoff 2009:501). Als Erinnerungsorte können also beispielsweise auch Artefakte, Denkmäler, historische Personen, Symbole, Texte, Rituale und Ereignisse fungieren. In den Erinnerungsorten kondensieren die Bestände des kulturellen Gedächtnisses (vgl. Badstübner-Kizik 2020:652), man kann sie als „‚Orte‘ im kollektiven Gedächtnis [begreifen], an denen Erinnerung festgemacht wird“ (ebd.:653). Mit den Erinnerungsorten ist die Vorstellung verbunden, dass Phänomene der Vergangenheit über Medien in die Gegenwart transportiert werden und auf diese Weise über lange Zeiträume hinweg für soziale Gruppen und ihre beteiligten Individuen identitätsstiftend wirken. Der Ansatz der Erinnerungsorte ist eine spezifische Art der Geschichtsbetrachtung, die nicht wie die klassischen Geschichtswissenschaften nach Chronologie, Linearität und Vollständigkeit in der Darstellung faktischer Tatsachen sucht. Nora bezeichnete sie daher auch als histoire au second degré (Nora 2002), Geschichte zweiten Grades. Diese fokussiert die Entstehung kollektiver Gedächtnisse und die identitätsstiftenden Funktionen der darin enthaltenen Phänomene (vgl. Koreik/Roche 2014:10), kann verdeckte Deutungsmuster und Werteorientierungen offenlegen und somit zu einem fremdkulturellen Verständnis beitragen (vgl. Fornoff 2009:505). In diesem Sinne wären auch „falsche“ Erinnerungen, sofern sie in der sozialen Gruppe eine Funktion erfüllen, von Bedeutung (vgl. dazu Badstübner-Kizik 2015b:98).
Als „das entscheidende Startsignal“ für das Konzept identifizieren Koreik und Roche (2014:9) für den deutschsprachigen Raum das dreibändige Werk Die deutschen Erinnerungsorte von François/Schulze (2001). Es handelt sich hier also um einen relativ jungen Ansatz, dessen Potential in der praktischen Anwendung noch nicht ausgeschöpft ist.
Anwendung erinnerungsperspektivischer Ansätze im Fremdsprachenunterricht
Betont Koreik (1995:70) Mitte der 1990er noch die Problematik der Konkretisierung der Theorie des kollektiven Gedächtnisses für die Praxis aufgrund eines Mangels an empirischer Nachweisbarkeit, so werden in neueren Veröffentlichungen die Vorteile einer erinnerungswissenschaftlichen Perspektive für die Vermittlung kultureller Inhalte hervorgehoben (so auch in Koreik 2015:15).
Durchgesetzt hat sich im DaF-Bereich die Betrachtungsweise des kulturellen Gedächtnisses nach Assmann und Assmann und insbesondere das Norasche Konzept der Erinnerungsorte hat hier regen Anklang gefunden. Dies betrifft nicht nur theoretische Überlegungen, sondern gleichermaßen Versuche einer praktischen Umsetzung bzw. der Didaktisierung für das kulturelle Lernen im Fremdsprachenunterricht. Zu den ersten dieser Versuche zählen die Lehrmaterialien von Schmidt und Schmidt (2007). Aktuellere Beschäftigungen mit Erinnerungsorten, die teilweise auch didaktische Empfehlungen beinhalten, finden sich in den Bänden Erinnerungsorte und Erinnerungskulturen (Roche/Röhling 2014) und Kulturelles Gedächtnis und Erinnerungsorte im hochschuldidaktischen Kontext (Badstübner-Kizik/Hille 2015). Das Netzwerk memodics (https://memodics.wordpress.com) stellt darüber hinaus neben einer Literaturliste auch konkrete Unterrichtsmaterialien zu Themen des kulturellen Gedächtnisses sowie zu deutsch-polnischen Erinnerungsorten zur Verfügung. Lehrkräfte, die das volle Potential eines erinnerungsperspektivischen Ansatzes im Landeskundeunterricht nutzen wollen, kommen jedoch nicht umhin, eigenes Material zu erstellen. Nicht zuletzt, weil die Auswahl für den Unterricht geeigneter Erinnerungsorte auch von lernergruppenspezifischen Faktoren abhängt. Die Auswahlkriterien von Badstübner-Kizik (2020:658 f.) helfen dabei, einzuschätzen, wann es sich bei einem kulturellen Phänomen um einen Erinnerungsort handelt. Aufgrund der Mediengebundenheit von Beständen des kollektiven Gedächtnisses schließt sich hier direkt die Frage nach der Medienauswahl an. In der Praxis hat sich ein Zusammenspiel von visuellen und schriftlichen Medien als besonders geeignet erwiesen (vgl. Fornoff 2009:509 f.). Bei der Verwendung von bereits vorhandenem landeskundlichem Lehrwerksmaterial ist Wachsamkeit geboten. Koreik (1995:75 ff.) entdeckte in DaF-Lehrwerken gravierende inhaltliche Fehler in der Darstellung historischer Gegebenheiten. Auch wenn dieser Fund mehr als zwanzig Jahre zurückliegt, ist das alarmierend. Faktenwissen schafft auch beim Ansatz der Erinnerungsorte eine wichtige Grundlage zum hier geforderten Verständnis komplexer Prozesse von Bedeutungszuschreibung (vgl. Fornoff/Koreik 2020:53).
Dem Aufwand der Materialprüfung und ‑erstellung gegenüber stehen die Vorteile, welche die Vermittlung kultureller Inhalte durch Erinnerungsorte mit sich bringt. Einer davon ist die potentiell integrativ wirkende Funktion. So kann das Lernen an Erinnerungsorten die Integration in die zielsprachliche Kultur unterstützen. Dies liegt zum einen in ihrem einschließenden oder — bei Nicht-Teilhabe — ausschließenden Charakter begründet (vgl. Badstübner-Kizik 2020:653). Laut Fornoff (2009:502) ist das kollektive Gedächtnis gar „das wichtigste Bindeglied einer sozialen Gruppe“. Zum anderen können hiermit „Wissensbestände […] aufgedeckt werden, die Voraussetzungen sprachlich kommunikativer Handlungen sind“ (ebd.:500).
Anlass zur Kritik gibt im Fach Deutsch als Fremdsprache der nationale Referenzrahmen, in dem der Ansatz der Erinnerungsorte entstanden ist (vgl. etwa Badstübner-Kizik 2014:43). Dies geschieht angesichts der Abwendung der Kulturwissenschaften von einem an Ländergrenzen orientierten Kulturbegriff im Sinne von Nationalkulturen hin zu einer Zuwendung zu einem dynamischen Verständnis von Kulturen mit dem ihnen innewohnendem (Re-)konstruktionscharakter (vgl. etwa Koreik/Roche 2014:9 und Badstübner-Kizik 2020:655). Altmayer (2017:9 f.) kritisiert in Anbetracht einer von Globalisierungs‑, Digitalisierungs- sowie Migrationsprozessen betroffenen Welt besonders vehement die vermeintlich nationalstaatliche Orientierung der Landeskunde und fordert eine Loslösung von solchen Konstrukten wie Nationalität oder Territorialität. Dagegen halten lässt sich erstens, dass „auch in Einwanderungsgesellschaften […] nationalhistorische Formen der Gedächtnisbildung identitätskonstitutiven Charakter [haben]“ (Fornoff/Koreik 2020:49; vgl. dazu auch auf die darin hingewiesenen Studien von Kölbl 2004 und 2008 zum Geschichtsbewusstsein von Jugendlichen in Deutschland). Zweitens kann der Ansatz der Erinnerungsorte auch in nicht nationalen Kontexten angewendet werden, (vgl. Fornoff/Koreik 2020:52 ff.). Ein Beleg dafür sind die Ansätze der geteilten, gemeinsamen und parallelen Erinnerungsorte, wie etwa im fünfbändigen Werk Deutsch-polnische Erinnerungsorte (Hahn/Traba 2012–2015) umgesetzt. Die genannten Ansätze lassen nicht nur die Gegenüberstellung inhaltlich gleicher oder ähnlicher Erinnerungsorte innerhalb verschiedener kollektiver Gedächtnisse zu, sondern auch den Vergleich inhaltlich unterschiedlicher Erinnerungsorte mit einer ähnlichen identitätsstiftenden Wirkung (sog. parallele Orte). Sensibilität beim Einsatz solch kulturkontrastiver Ansätze bedarf es bei Lernenden, die aus Kulturen ohne gedächtnisgeschichtliche Denkweisen stammen, denn diese könnten sich in ihrer Identität angegriffen fühlen (vgl. Fornoff 2009:514 f.).
Koreik und Roche (2014:21 f.) sehen das Konzept der Erinnerungsorte zudem als dazu geeignet, den Transdifferenzansatz im fremdsprachlichen Landeskundeunterricht umzusetzen. Bei diesem Ansatz geht es darum, Differenzen zu betonen und den Umgang mit ihnen zu erproben. Am Ende steht weder deren Auflösung noch die Übernahme des Fremden ins Eigene, was die Arbeit mit Erinnerungsorten eben nicht zwingend verlangt (vgl. ebd.).
Die Konzeption der Erinnerungsorte wird nicht zuletzt als Chance wahrgenommen, die Forderung der ABCD-Thesen (IDV 1990:17) zu erfüllen, im fremdsprachlichen Landeskundeunterricht historische Inhalte mit Gegenwartsbezug zu vermitteln (vgl. Badstübner-Kizik 2020:655; Fornoff 2009:506 f.; Koreik 2015:23), da „hier Phänomene fokussiert [werden], die es […] aus der Vergangenheit in die Gegenwart ‚geschafft‘ haben“ (Badstübner-Kizik 2020:655). Vor einer zu oberflächlichen Betrachtungsweise dieser Phänomene kann der Ansatz jedoch nicht schützen (vgl. Koreik/Roche 2014:9).
Koreiks Befürchtung, dass den Erinnerungsorten dasselbe Schicksal wie dem Konzept der Interkulturalität ereilt und sie sich durch einen inflationären Begriffsgebrauch zu einer reinen Modeerscheinung entwickeln (vgl. Koreik 2015:30), hat sich bisher noch nicht bestätigt. Im Gegenteil, das Ende des sogenannten Erinnerungsbooms ist noch nicht absehbar.
Literatur
Altmayer, Claus (2017), Landeskunde im Globalisierungskontext. Wozu noch Kultur im DaF-Unterricht? In: Haase, Peter & Höller, Michaela (Hrsg.), Kulturelles Lernen im DaF/DaZ-Unterricht. Paradigmenwechsel in der Landeskunde. Göttingen: Universitätsverlag, 3–22.
Assmann, Aleida (2014), Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik (2. Auflage). München: Beck.
Assmann, Jan (1988), Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität. In: Assmann, Jan & Hölscher, Toni (Hrsg.), Kultur und Gedächtnis. Frankfurt am Main: Suhrkamp [suhrkamp taschenbuch wissenschaft; 724], 9–19.
Badstübner-Kizik, Camilla (2014), ‚Erinnerungsorte‘ in der fremdsprachlichen Kulturdidaktik. Anmerkungen zu ihrem didaktisch-methodischen Potential. In: Mackus, Nicole & Jupp, Möhring (Hrsg.), Wege für Bildung, Beruf und Gesellschaft – mit Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. 38. Jahrestagung des Fachverbands Deutsch als Fremdsprache an der Universität Leipzig 2011. Göttingen: Universitätsverlag, 43–64.
Badstübner-Kizik, Camilla (2015a), Medialisierte Erinnerung als didaktische Chance. In: Badstübner-Kizik, Camilla & Hille, Almut (Hrsg.), Kulturelles Gedächtnis und Erinnerungsorte im hochschuldidaktischen Kontext. Perspektiven für das Fach Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt am Main: Peter Lang [Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik; 7], 37–63.
Badstübner-Kizik, Camilla (2015b), Rezension zu Udo O. H. Jung. Deutsche SchildBürgerKunde. Das ausgestellte Gedächtnis der Nation. Glottodidactica 42: 1, 97–102.
Badstübner-Kizik, Camilla (2020), Kulturelles Gedächtnis und Erinnerungsorte im Kontext Deutsch als Fremdsprache. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 25: 1, 650–675.
Badstübner-Kizik, Camilla & Hille, Almut (Hrsg.) (2015), Kulturelles Gedächtnis und Erinnerungsorte im hochschuldidaktischen Kontext. Perspektiven für das Fach Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt am Main: Peter Lang [Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik; 7].
Fornoff, Roger (2009), Erinnerungsgeschichtliche Deutschlandstudien in Bulgarien. Theoriekonzepte – unterrichtspraktische Ansätze – Lehrerfahrungen. Information Deutsch als Fremdsprache 36: 6, 499–517.
Fornoff, Roger & Koreik, Uwe (2020), Ist der kulturwissenschaftliche und kulturdidaktische Bezug auf die Nation überholt? DACH-Landeskunde, Globalisierung und Erinnerungsorte. Eine Intervention. In: Shafer, Noemi; Middeke, Annegret; Hägi-Mead, Sara & Schweiger, Hannes (Hrsg.), Weitergedacht. Das DACH-Prinzip in der Praxis. Göttingen: Universitätsverlag, 37–68.
François, Etienne & Schulze, Hagen (Hrsg.) (2001), Deutsche Erinnerungsorte. München: Beck.
Hahn, Hans Henning & Traba, Robert (Hrsg.) (2012 – 2015), Deutsch-polnische Erinnerungsorte. Band 1 bis 5. Paderborn: Schöningh.
Halbwachs, Maurice (1925), Les cadres sociaux de la mémoire. Paris: Presses Universitaires de France.
Halbwachs, Maurice (1939), La mémoire collective. Paris: Presses Universitaires de France.
Halbwachs, Maurice (1985), Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen. Berlin: Suhrkamp [suhrkamp taschenbuch wissenschaft; 538].
IDV (Hrsg.) (1990), ABCD-Thesen zur Rolle der Landeskunde im Deutschunterricht. IDV Rundbrief 45, 15–17.
Kölbl, Carlos (2004), Geschichtsbewußtsein im Jugendalter. Grundzüge einer Entwicklungspsychologie historischer Sinnbildung. Bielefeld: transcript.
Kölbl, Carlos (2008), „Ausschwitz ist eine Stadt in Polen“. Zur Bedeutung der NS-Vergangenheit im Geschichtsbewußtsein junger Migrantinnen und Migranten. In: Baricelli, Michele & Hornig, Julia (Hrsg.), Aufklärung, Bildung, „Histotainment“? Zeitgeschichte im Unterricht und Gesellschaft heute. Frankfurt am Main: Peter Lang, 161–173.
Koreik, Uwe (1995), Deutschlandstudien und deutsche Geschichte. Die deutsche Geschichte im Rahmen des Landeskundeunterrichts für Deutsch als Fremdsprache. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
Koreik, Uwe (2015), Landeskunde, Geschichte und „Erinnerungsorte“ im Fremdsprachenunterricht. In: Badstübner-Kizik, Camilla & Hille, Almut (Hrsg.), Kulturelles Gedächtnis und Erinnerungsorte im hochschuldidaktischen Kontext. Perspektiven für das Fach Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt am Main: Peter Lang [Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik; 7], 15–35.
Koreik, Uwe & Roche, Jörg (2014), Zum Konzept der „Erinnerungsorte“ in der Landeskunde Deutsch als Fremdsprache – eine Einführung. In: Roche, Jörg & Röhling, Jürgen (Hrsg.), Erinnerungsorte und Erinnerungskulturen. Konzepte und Perspektiven für die Sprach- und Kulturvermittlung. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren [Perspektiven Deutsch als Fremdsprache; 27], 9–6.
Nora, Pierre (Hrsg.) (1984 – 1992), Les lieux de mémoire. Band 1 bis 7. Paris: Gallimard.
Nora, Pierre (2002), Pour une histoire au second degré. Le Débat 5: 122, 24–31.
Roche, Jörg & Röhling, Jürgen (Hrsg.) (2014), Erinnerungsorte und Erinnerungskulturen. Konzepte und Perspektiven für die Sprach- und Kulturvermittlung. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren [Perspektiven Deutsch als Fremdsprache; 27].
Schmidt, Sabine & Schmidt, Karin (2007), Erinnerungsorte. Deutsche Geschichte im DaF-Unterricht. Berlin: Cornelsen.